Genuss beginnt mit Verantwortung

Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes Deutscher Sektkellereien e.V. (VDS) stehen für einen verantwortungsvollen Umgang mit alkoholischen Getränken. Eigenverantwortung bedeutet, Grenzen zu kennen: Im Straßenverkehr, während der Schwangerschaft, am Arbeitsplatz, beim Sport, bei der Einnahme von Medikamenten und für Minderjährige gilt Punktnüchternheit. Prävention, transparente Information und klare Regeln haben in den letzten Jahren nachweislich dazu beigetragen, schädlichen Alkoholkonsum zu verringern. Das betrifft Rauschtrinken, Alkohol am Steuer und den Konsum bei Minderjährigen.
Verantwortung und Lebensfreude gehören für uns zusammen. Verbote und Steuererhöhungen dagegen sind keine Lösung. Entscheidend sind Aufklärung, Eigenverantwortung und ein Umfeld, in dem Konsumenten bewusst mit alkoholischen Getränken umgehen. Als Branche fördern wir ausschließlich verantwortungsvollen Genuss – mit Aufklärung, Haltung und einem eindeutigen Bekenntnis gegen Missbrauch. Folgende Initiativen unterstützen wir in diesem Kontext:

Mit der Initiative „Wine in Moderation“ (WiM) setzen wir europaweit ein Zeichen für eine verantwortungsvolle Weinkultur. Sie verbindet Aufklärung mit dem kulturellen Wert des Weines und vermittelt die Botschaft: „Bewusst entscheiden – bewusst genießen – bewusst verzichten“.

Seit 1993 klären wir mit der Kampagne „DON’T DRINK AND DRIVE“ (DDAD) über die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr auf und appellieren: „Wer fährt, bleibt nüchtern!“ In der DDAD Academy lernen junge Menschen praxisnah, wie Alkohol Reaktionsfähigkeit und Wahrnehmung beeinträchtigt – und dass bewusste Nüchternheit Leben retten kann.
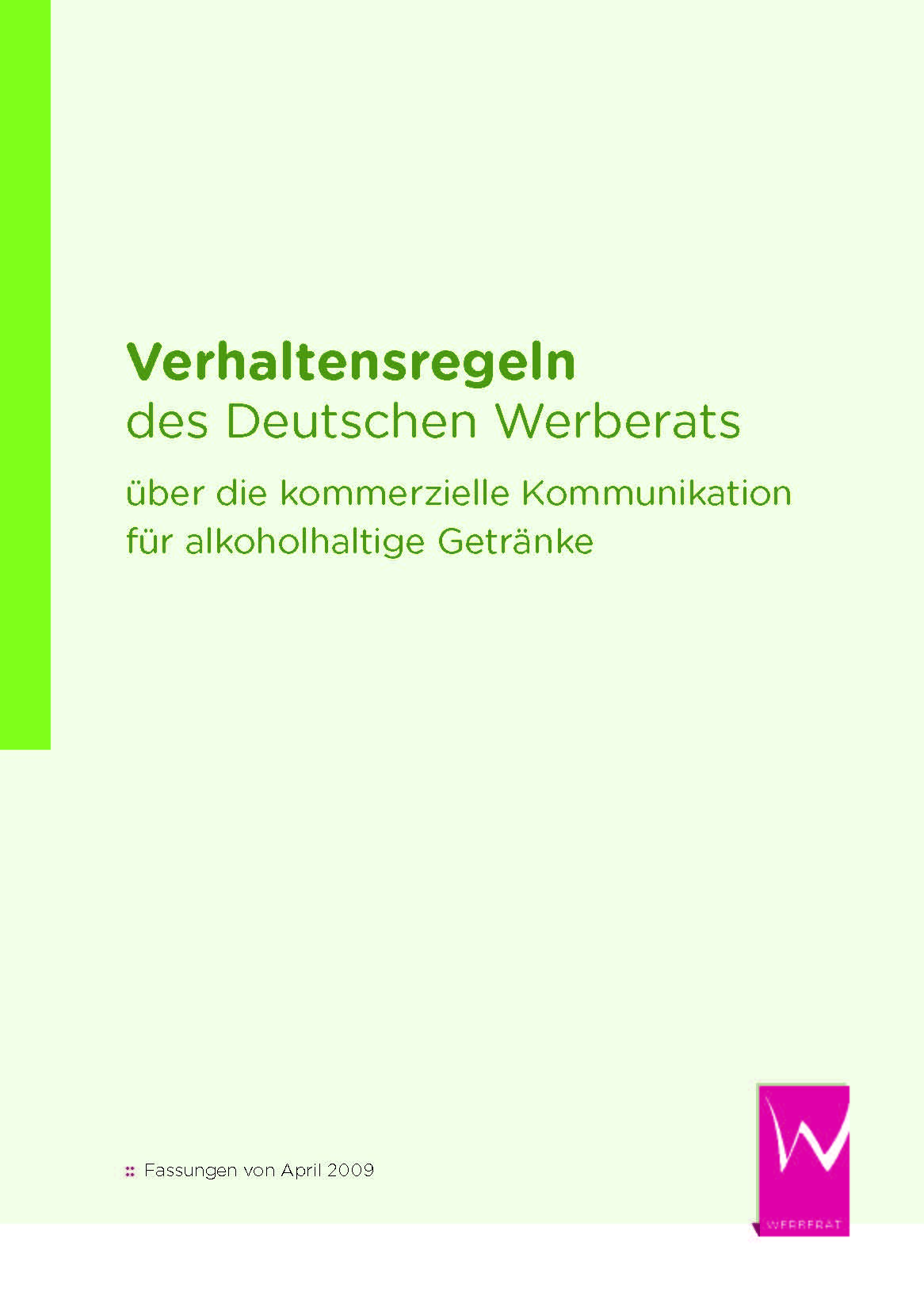
Auch in der Werbung für Sekt, Wein und Spirituosen halten wir uns an strenge gesetzliche Vorgaben. Über die rechtlichen Vorgaben hinaus nimmt die Branche alkoholischer Getränke seit Jahrzehnten ihre Verantwortung für die Darstellung und Bewerbung ihrer Produkte im Rahmen einer freiwilligen Selbstregulierung wahr und orientiert sich dabei an den „Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke“. Damit schützen wir insbesondere Kinder und Jugendliche und schließen jede Form der Aufforderung zum Missbrauch aus.
Sekt bewusst genießen – richtig handeln
Sekt zu feierlichen Anlässen zu genießen, verbindet Menschen weltweit. Kaum ein anderes Getränk schafft es, hohe kulturelle Werte und emotionale Momente zu vereinen. Die deutsche Sekt-Landschaft bietet dabei eine unvergleichliche Produktvielfalt und Qualität für jeden Geschmack und Anlass. Ob Traditionsmarke oder Neuschöpfung, unsere Sektkellereien machen hochwertige Produkte in der ganzen Welt erlebbar. Es ist daher kein Wunder, dass Deutschland den größten und umsatzstärksten Sektmarkt weltweit hat.
Bei besonderen oder alltäglichen Begegnungen, erfolgreichen Projektabschlüssen, Siegerfreuden oder in geselliger Runde Sekt zu trinken, ist in unserem Lebensgefühl seit Jahrzehnten fest verankert. Als Branche sind wir stolz darauf, dass Sekt im In- und Ausland großes Ansehen genießt und so zum Schutz von aktiv gelebter Weinbaukultur beiträgt.
Sektgenuss hat immer auch etwas mit dem richtigen Maß zu tun. Nur so können wir die Qualität eines alkoholischen Getränkes intensiv erleben und das dazugehörige Erlebnis wertschätzen. Der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit alkoholischen Getränken ist eine gewissenhafte Aufgabe und erfordert Kenntnisse über die Wirkung von Alkohol, gesunde Lebensgewohnheiten sowie ein risikoarmes Umfeld für missbräuchlichen Alkoholkonsum.
Die deutschen Sekthersteller sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Sie fördern ausschließlich den verantwortungsvollen Genuss ihrer Produkte und lehnen jegliche Form des missbräuchlichen Alkoholkonsums ab. Die Mitglieder des Verbandes Deutscher Sektkellereien e.V. (VDS) sind sich einig, dass bestimmte Lebenssituationen einen bewussten Verzicht auf alkoholische Getränke erfordern, um weder die eigene Gesundheit noch die Gesundheit Dritter zu gefährden. Im Straßenverkehr, während der Schwangerschaft, am Arbeitsplatz, beim Sport oder bei der Einnahme von Medikamenten und für jüngere Altersgruppen darf es keine Kompromisse geben.
Gemeinsam mit seinem Partnerverband, dem Bundesverband Wein und Spirituosen International e.V., bezieht der VDS zu zentralen Fragen im Zusammenhang mit dem Konsum alkoholischer Getränke eine klare Haltung:
Verantwortung zum Schutz der eigenen oder anderer Gesundheit
Gesellschaftliche Verantwortung
Konsum von alkoholhaltigen Getränken verändert das Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen, wodurch es gerade im Straßenverkehr zu einer massiven Gefährdung der eigenen und der Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer kommen kann.
Entscheidend ist daher, durch zielgruppenspezifische Aufklärungskampagnen schon frühzeitig Jugendliche und junge Erwachsene auf die Gefahren im Zusammenhang mit dem Konsum alkoholhaltiger Getränke und der Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren. Die frühzeitige Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen, beginnend im Elternhaus, in der Schule und natürlich im Rahmen der Fahrausbildung, leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag.
Gerade in der Gruppe der jungen Autofahrer schätzen einige ihr Können am Steuer falsch ein und sind daher einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt. Eine falsche Einschätzung der Situation in Kombination mit Alkohol vergrößert das Risiko noch. Auch wenn die Anzahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle seit 1991 kontinuierlich sinkt, sind junge Fahrer und Fahranfänger noch immer überproportional häufig an Alkoholunfällen beteiligt. Mangelnde Fahrpraxis, Selbstüberschätzung und ein geringes Wissen über die körperlichen Auswirkungen von Alkohol erhöhen deren Risiko.
Die Verkehrssicherheits-Präventionsinitiative „DON’T DRINK AND DRIVE“, die der VDS zusammen mit seinem Partnerverband, dem Bundesverband Wein und Spirituosen International e.V., und weiteren Wirtschaftsverbänden für alkoholhaltige Getränke durchführt, richtet sich speziell an junge Fahrerinnen und Fahrer. Die Kampagne stellt Aufklärung und Risikokompetenz in den Mittelpunkt und unterstützt so nachhaltig die Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Jugendschutz hat für den VDS eine hohe Priorität. Zu Recht sind der Erwerb und der Konsum alkoholhaltiger Getränke in Deutschland durch das Jugendschutzgesetz geregelt und vom Gesetzgeber an eine Altersgrenze gekoppelt. § 9 des Jugendschutzgesetzes schreibt vor, dass eine Abgabe von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit verboten ist. Erst ab dem 16. Geburtstag ist der Konsum von Wein, Sekt, Bier und entsprechenden Mischgetränken erlaubt. Für stark alkoholische Getränke wie Schnaps, Likör, Alkopops, aber auch branntweinhaltige Getränke liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.
Doch Jugendschutz ist für uns nicht nur eine gesetzliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung.
Für die leichtalkoholischen Getränke Sekt, Wein und Bier trägt die Altersgrenze von 16 Jahren zum Erfahren eines verantwortungsbewussten Genusskonsums von alkoholhaltigen Getränken bei. Zumeist findet der Konsum zunächst bei gemeinsamen Essen oder privaten Feiern im familiären Umfeld begleitend mit Erziehungsberechtigten statt. Diese leisten einen wichtigen Beitrag zum schrittweisen Erfahren eines verantwortungsvollen und moderaten Konsums von alkoholhaltigen Getränken. Für Jugendliche ist das Trinken alkoholhaltiger Getränke oft Ausdruck eines Erwachsenwerdens und Erwachsenseins. Bei der Suche nach Grenzerfahrungen sind neben der Familie auch Gleichaltrige und das Freizeitverhalten entscheidende Einflussfaktoren.
Im Alter zwischen 16 und 18 Jahren beginnt ein großer Teil der Jugendlichen eigenverantwortlich und unabhängig von der Familie am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Erziehung junger Erwachsener zu einem verantwortungsbewussten Konsum alkoholhaltiger Getränke braucht einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Entsprechend vertreten wir Lösungsansätze, die junge Menschen über den Erkenntnisgewinn und nicht über normative Vorschriften abholen. Darüber hinaus bestünde die Gefahr, dass der Reiz des Verbotenen diese Altersklasse sogar zu vermehrtem Konsum anregen könnte. Ziel muss es vielmehr sein, durch langfristige und nachhaltige Präventionsarbeit die Gefahr eines missbräuchlichen Konsums zu minimieren. Prävention bedeutet in diesem Zusammenhang Aufklärungsarbeit zur Stärkung des Bewusstseins der Jugendlichen im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen Genussmitteln, beginnend in Elternhaus und Schule. Zu Erziehung und Prävention gibt es keine Alternative.
Die Frage, ob ein Glas Alkohol während der Schwangerschaft nicht wenigstens gelegentlich vertretbar sei, lässt keinen Interpretationsspielraum offen: Jeder Genuss von alkoholischen Getränken während der Schwangerschaft ist tabu.
Die Folgen von Alkoholkonsum für das ungeborene Kind werden auch in Deutschland häufig noch unterschätzt. Das sich im Mutterleib entwickelnde Kind trinkt jeden Schluck Alkohol, den die Mutter konsumiert, mit. Nährstoffe und auch Ethanol (Alkohol) können die Plazenta durchdringen und ungefiltert in den Blutkreislauf sowie in das Gehirn des Fötus gelangen. Da aber beim heranwachsenden Baby weder die zum Abbau notwendige Alkoholdehydrogenase (ADH) noch die Aldehyddehydrogenase (ALDH) zur Entgiftung ausreichend entwickelt sind, baut die kindliche Leber Alkohol nur unzureichend ab. Dabei besteht kein Unterschied, ob sich das Ungeborene in dem Embryonalstadium oder in der Fetalphase befindet. Noch stärker reagiert das Gehirn des Fötus auf die Wirkung des Alkohols. Wenn die Zellteilung an einem Tag nicht funktionieren sollte, fehlt ein Entwicklungsschritt. Da sich die Hirnreifung über die gesamte Schwangerschaft vollzieht, ist eine Schädigung meistens irreparabel.
Im schlimmsten Fall kann ein Zuviel an Alkohol in der Schwangerschaft zum Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) führen und vielfältige Krankheitsbilder wie Wachstumsstörungen, Herzfehler, Sprachstörungen oder Hyperaktivität beim Kind nach sich ziehen. Merkmale wie ein ungewöhnlich kleiner Kopfumfang oder Verformungen im Gesichtsbereich sind typisch für alkoholbedingte Schädigungen. Nach Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind 80 % der vom Fetalen Alkoholsyndrom Betroffenen lebenslang auf fremde Hilfe angewiesen.
Ein konsequenter Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft ist unerlässlich. Nur so können alkoholbedingte Beeinträchtigungen wie körperliche, geistig-intellektuelle Defizite oder psychische Auffälligkeiten vermieden werden.
Häufig ist der Konsum von Alkohol am Arbeitsplatz arbeitsrechtlich geregelt. Unternehmen können den Konsum von Alkohol während der Arbeitszeit oder der Pausen individuell untersagen. Doch auch, wenn es keine allgemeingültige, gesetzlich festgelegte Promille-Grenze für Arbeitnehmer gibt, sollte man in der Arbeitszeit seinen Alkoholkonsum besser auf null setzen.
Denn da, wo Alkohol im Spiel ist, ist beim Bedienen von Maschinen oder Fahrzeugen die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer gefährdet. Ebenso leiden Qualität und Effizienz der Arbeit.
Alkohol am Arbeitsplatz zieht mitunter ernsthafte Folgen und arbeitsrechtliche Konsequenzen wie zum Beispiel eine Abmahnung oder Kündigung nach sich. Auch der Unfallversicherungsschutz kann durch eine sogenannte Alkoholklausel bei Unfällen am Arbeitsplatz entfallen.
Wer sportlich aktiv ist, sollte vor und nach dem Training in jedem Fall auf Alkohol verzichten. Unter Alkoholeinfluss sinken Koordinations- und Reaktionsfähigkeit, wodurch das Risiko für Sportverletzungen steigt. Für den Aufbau von Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer wirkt sich der Genuss alkoholischer Getränke negativ aus. Die Blutgefäße weiten sich, das Herz muss mehr Pumpkraft aufwenden, der Körper kühlt schneller aus und verliert Energie. Dazu kommt, dass die dehydrierende Wirkung von Alkohol dafür sorgt, dass der Körper bereits vor dem Fitnessprogramm Flüssigkeit verloren hat. Vermehrtes Schwitzen durch körperliche Anstrengung führt dazu, dass man dem schon ausgetrockneten Organismus weitere Flüssigkeit und damit auch Mineralstoffe entzieht.
Auch unmittelbar nach dem Sport bietet es sich nicht an, den Durst mit Alkohol zu löschen. Da Alkohol dem Körper Wasser entzieht, können Stoffwechselvorgänge, die für den Muskelaufbau und die Regeneration nötig sind, sonst nur eingeschränkt stattfinden. Im Idealfall sollten zwischen dem sportlichen Training und dem Konsum eines alkoholhaltigen Getränks einige Stunden vergehen.
Mit einer maßvollen und bewussten Haltung lassen sich der Genuss alkoholischer Getränke und sportliche Aktivitäten mühelos in Einklang bringen.
Aufgrund von Wechselwirkungen vertragen sich viele Arzneimittel nicht mit Alkohol. Wer krank ist oder Medikamente einnimmt, sollte keinen Alkohol trinken und sich von einem Arzt oder Apotheker beraten lassen.
Manche Arzneistoffe hemmen das Enzym, das für den Abbau des Alkohols wichtig ist, und das entstehende Zwischenprodukt Acetaldehyd kann nicht weiter abgebaut werden und reichert sich an. Verzögerter Alkohol- und Medikamentenabbau sowie toxische Stoffwechselprodukte sind die Folge. Andere Arzneimittel verstärken oder verringern die Wirkung eines Medikamentes in Kombination mit Alkohol oder führen zu unvorhergesehenen Nebenwirkungen. Bei sedierenden Medikamenten kann der gleichzeitige Alkoholeinfluss sogar lebensgefährliche Folgen hervorrufen. Daher ist es grundsätzlich nicht ratsam alkoholische Getränke und eine Medikamenteneinnahme zu kombinieren.
Werbung schafft einen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Mehrwert und ist ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Meinungsbildung. In Bezug auf Alkoholwerbung schreibt Deutschland eine klare gesetzlich Regulierung vor. Über die rechtlichen Vorgaben hinaus nimmt die deutsche Alkoholwirtschaft seit Jahrzehnten ihre Verantwortung für die Darstellung und Bewerbung ihrer Produkte im Rahmen einer Selbstregulierung wahr und orientiert sich an den „Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke“.
Das Regelwerk wurde schon 1976 unter dem Dach des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) verabschiedet. Die 2009 geschaffene Erweiterung dieser Regelung schützt vor allem Kinder und Jugendliche. Kommerzielle Kommunikation darf Kinder und Jugendliche weder beim Trinken oder bei einer Aufforderung zum Trinken zeigen noch eine Aufforderung sein, alkoholhaltige Getränke zu konsumieren. Auch dürfen keine jugendaffinen Gestaltungselemente verwendet werden, die sich in ihrer Ansprache an Kinder und Jugendliche richten. Die Hersteller alkoholhaltiger Getränke müssen bei Ihren online-Auftritten eine Altersschranke einrichten.
Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, missbräuchlichen Alkoholkonsum zu visualisieren oder zu verharmlosen. Auch verstößt eine Werbung gegen die Verhaltensregeln des Deutschen Werberates über die Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke, wenn sie eine Botschaft transportiert, die einen exzessiven Alkoholgenuss für die Überwindung von Problemen, das Erreichen einer besonderen Leistung oder eines sozialen Erfolges verantwortlich macht.
Mit der Achtung dieser Verhaltensregeln bekennen sich die deutschen Sekthersteller zu ihrer Verpflichtung, kommerzielle Kommunikation für ihre Produkte verantwortungsbewusst zu gestalten. Werbung für alkoholhaltige Getränke erfüllt auf diese Weise die geforderten Standards.
Die Evaluation und die Effektivität der Werbeselbstkontrolle in Deutschland obliegen mit dem Deutschen Werberat einem unabhängigen Gremium. Die wenigen, unerheblichen Beanstandungen des Werberates über die Jahre zeigen, dass der Selbstregulierungsmechanismus der Wirtschaft erfolgreich funktioniert.
Eine hin und wieder geforderte umfangreichere Werbeeinschränkung für alkoholhaltige Getränke verfehlt nach Ansicht der deutschen Sekthersteller das angestrebte Ziel missbräuchlichen Alkoholkonsum zu reduzieren. Beispiele aus den skandinavischen Ländern zeigen, dass ein Verbannen der Werbung aus digitalen und gedruckten Medien weder zu einem Konsumrückgang führt noch zu einem anderen Konsumverhalten beiträgt. Gemäß des Drogenberichtes des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen ist der Alkoholkonsum der Deutschen seit Jahren rückläufig, was unterstreicht, dass die Selbstverpflichtung der Branche besser wirkt als Restriktionen.
Der Vertrieb alkoholhaltiger Produkte ist in Deutschland gesetzlich klar geregelt (vgl. Alkohol und Jugendschutz). Dennoch fordern Politiker Maßnahmen, die die Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken weiter beschränken sollen. Bisher gibt es in Bezug auf Missbrauchsreduzierung keinen wissenschaftlichen Nachweis für die Wirksamkeit von Verkaufsbeschränkungen. Verbote und Beschränkungen in der Verfügbarkeit für alkoholhaltige Getränken gehen daher am Ziel der Missbrauchsbekämpfung vorbei und belasten Verbraucher, die Alkohol moderat konsumieren. Beispiele aus skandinavischen Ländern zeigen, dass die reglementierte Beschaffung alkoholischer Getränke umgangen wird und gesundheitsschädliche Konsummuster trotz eingeschränkter Verfügbarkeit bestehen. Wer alkoholhaltige Getränke für Rausch- und Suchtmomente konsumieren will, findet seinen Weg, kauft auf Vorrat oder über das Internet. Das Problem verlagert sich ohne soziale Kontrolle ins Private.
Wichtig ist es, ein kontrolliertes Umfeld zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs zu schaffen, in dem bestehende Regulierungen und Gesetze streng eingehalten werden. Parallel dazu ist es ratsam, als junger Erwachsener einen verantwortungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen Getränken zu erlernen, damit Verbote keine Anziehungskraft ausüben.
Oberflächlich betrachtet, scheint das politische Modell, alkoholische Getränke zu besteuern, möglicherweise attraktiv. Neben fiskalischen Gründen wird oft das gesundheitspolitische Argument der Lenkungswirkung in die Waagschale geworfen. Demnach würden höhere Steuern auf alkoholische Produkte zu weniger Konsum und geringeren Gesundheitsschäden führen. Eine derartige Verteuerung alkoholhaltiger Getränke innerhalb der EU führt zu Wettbewerbsverzerrungen und Ausweichbewegungen im Markt und schafft sogar Anreize dafür, dass der Handel mit alkoholischen Produkten auf dem Schwarzmarkt interessant erscheint und die illegal gehandelte Ware steuerlich nicht erfasst wird. Preiserhöhungen sind daher nicht geeignet den missbräuchlichen Alkoholkonsum ursächlich zu bekämpfen. Stattdessen belasten sie diejenigen, die Alkohol maßvoll und verantwortungsbewusst konsumieren. Für die Wirksamkeit der Besteuerung als gesundheitspolitisches Instrument gibt es bisher keine empirischen Belege.
Steuererhöhungen allein haben bislang noch niemanden gesund gemacht. Der Verband Deutscher Sektkellereien e.V. wünscht sich einen ehrlichen politischen Wettbewerb um die richtigen Maßnahmen und plädiert dafür, bei alkoholischen Getränken zwischen Genuss und Missbrauch klar zu unterscheiden. Zentrale Bausteine zur Verringerung des schädlichen Alkoholkonsums bleiben Prävention und verantwortungsvolles Handeln. Das gilt gleichermaßen für Verbraucher und Hersteller. Mit den Kampagnen „Wine in Moderation“ und „DON’T DRINK AND DRIVE“ leisten die Wirtschaftsbeteiligten initiativ einen bedeutenden Beitrag zur Aufklärung und eigenverantwortlichen Kompetenz der Konsumenten. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen lässt sich an statistischen Erhebungen ablesen.

 Deutsch
Deutsch
 English
English





